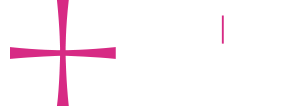Sind Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe gesetzlich unfallversichert?
Ja. Für den Bereich der verfassten Kirche hat die Evangelische Kirche in Deutschland eine Pauschalvertrag geschlossen, mit dem auch das ehrenamtliche Engagement in von der Kirche getragenen Initiativen in der Flüchtlingshilfe abgedeckt ist. Ist nicht die Kirche Träger der Initiativen, sondern eine Kommune, besteht Versicherungsschutz über die Kommune, wenn der Einsatz im Auftrag der Kommune erfolgt.
Nicht versichert in der gesetzlichen Unfallversicherung sind dagegen private Initiativen. Das Kirchenamt der EKD empfiehlt, in geeigneter Weise zu dokumentieren, dass entsprechende Initiativen im kirchlichen Auftrag und in kirchlicher Trägerschaft geschehen. Weiterhin könnten zur Dokumentation des ehrenamtlichen Engagements entsprechende Namenslisten geführt werden.
Sollten Ehrenamtliche im Gottesdienst eingeführt werden?
Pfarrerinnen und Pfarrer werden öffentlich in einem Gottesdienst eingeführt, Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter auch, bei Hauptamtlichen ist dies eine Selbstverständlichkeit. Bei Ehrenamtlichen wird das unterschiedlich gehandhabt: Für die Einführung von KirchenvorsteherInnen, LektorInnen, PrädikantInnen gibt es bewährte liturgische Formen für die Einführung in einem Gottesdienst.
Was aber gilt es zu bedenken bei der Einführung von anderen Ehrenamtlichen?
Mehr erfahren
Eine Anfrage: Wie bekomme ich Ehrenamtliche dazu, das zu tun, was gerade dran ist und nicht nur das, wozu sie gerade Lust haben?
Danke für diese Steilvorlage! Wann spricht jemand so unverblümt die Frage aus, die auch anderen schon mal durch den Kopf geht. Erst einmal möchte ich mit dieser Frage spielen: Wie klingt sie, wenn ich sie einfach „umdrehe“ und zurückfrage: Wie bekomme ich Hauptamtliche dazu, wahrzunehmen, dass das, wozu ich Lust habe, auch dran sein könnte? Vielleicht ist ja das, wozu Ehrenamtliche Lust haben, auch ein Maßstab für das, was dran ist. Wozu niemand Lust hat bzw. wozu niemand motiviert ist, wird sich nicht in die Tat umsetzen lassen, und wenn doch, dann wenig Resonanz finden, auch wenn ich noch so sehr der Meinung bin, dass es dran sei.
Was sind eigentlich die Maßstäbe für das, was dran ist, und wer entscheidet darüber?
Die ganze Antwort finden Sie als Download hier!
Wie werbe ich Freiwillige? Öffentlichkeitsarbeit
Da gibt es diese wunderbare Geschichte von dem Mann, der sich vor dem Schlafengehen vor sein Bett kniet, die Hände faltet und betet: Herr, bitte, lass mich im Lotto gewinnen. Das wiederholt er Samstag für Samstag, Woche um Woche, doch nichts passiert – kein erfreuliches Schreiben landet im Briefkasten, kein Lottobote klingelt an der Tür. So vergehen Monate. Eines Abends, als der Mann wieder vor seinem Bett kniet und fleht, „Herr, ich bete nun schon so lange, bitte erhöre mich und lass mich endlich im Lotto gewinnen!“, ist das Zimmer auf einmal in gleißendes Licht getaucht und eine resignierte Stimme ertönt von oben: „Gib mir eine Chance. Kauf dir ein Los.“
Auf Ihre Suche nach Freiwilligen übertragen, bedeutet das: Solange Sie nicht kommunizieren, in welchen Bereichen Ehrenamtliche in Ihrer Gemeinde oder Einrichtung arbeiten (können) und dass Sie sich über neue Freiwillige freuen, müssen Sie sich nicht wundern, dass keine/r an Ihre Tür klopft!
Welche Trümpfe Sie dafür zum Einsatz bringen können, erfahren Sie hier!
Wie begleite ich Ehrenamtliche?
Viele Menschen sind grundsätzlich motiviert ehrenamtlich aktiv zu werden, oder waren es auch schon in anderen Phasen ihres Lebens. In der Arbeit mit Freiwilligen stellt sich deshalb für uns die Aufgabe, diesen Motiven auf den Grund zu gehen und dafür zu sorgen, dass beginnende Ehrenamtliche möglichst wenigen Motivationskillern in ihrer Arbeit begegnen. Mehr über die Phasen Start – Reflexion – Qualifizierung erfahren Sie hier!
Brauchen wir Ehrenamtliche?
Die Stunde der Ehrenamtlichen schlägt oftmals dann, wenn die bestehende Arbeit mit den vorhandenen hauptamtlich Tätigen nicht mehr zu bewältigen ist oder wenn es für neue Aufgaben keine Hauptamtlichen gibt. Im ersten Fall sichern Ehrenamtliche bestehende Arbeitsfelder. Im zweiten Fall leisten Ehrenamtliche Pionierarbeit. In beiden Fällen sind Ehrenamtliche unverzichtbar.
Ehrenamtliche sind Kundschafter und Entdecker im „Gelände des noch nicht Ge-dachten oder Getanen“. Sie wenden sich Themen und Herausforderungen jenseits geklärter und (re-)finanzierter Zuständigkeiten zu. Sie fangen einfach an und machen was notwendig ist. Gemeinden, Einrichtungen und Werke brauchen solche „Scouts“, um mit gesellschaftlichen Veränderungen Schritt halten zu können.
Ehrenamtliche sind Anwälte und Botschafter ihrer Engagementfelder. Wo sie sind, da ist auch ihr Ehrenamt: im Verein, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, am Stammtisch oder im Kaffeekränzchen usw. Ehrenamtliche können dort, wo sie sind, über ihr Engagement erzählen, dafür werben, Missverständnisse klären, Kontakte knüpfen und Vorurteile abbauen.
Ohne Ehrenamtliche bleibt die Rede vom Priestertum aller Gläubigen nur eine Wort-hülse, während es mit Ehrenamtlichen fassbar und erlebbar wird.
Mit den drei Worten der fragenden Überschrift lässt sich die schlichte Antwort for-mulieren: Wir brauchen Ehrenamtliche.
Wann brauchen wir keine Ehrenamtlichen?
Ehrenamtliche müssen gewollt sein, und sie brauchen Aufgaben, für die sie sich entscheiden können, weil sie ihren Beweggründen für ein Engagement entsprechen. Ehrenamtliche müssen verlässliche Strukturen und Ansprechpartner vorfinden, damit sie sich – sinnvoll, kräfteschonend und begeistert zugleich – ihren Aufgaben zuwenden können. Ehrenamtliche brauchen ein Umfeld, in dem neue Ideen nicht als Störung, sondern als diskussionswürdige Möglichkeit angesehen werden. Mit Eh-renamtlichen kann nicht alles beim Alten bleiben.
Es braucht stets eine grundsätzliche Veränderungsbereitschaft. Wenn das nicht sichergestellt ist, dann sollten Ehrenamtliche besser nicht angeworben werden. Denn in einer solchen Situation sind Enttäuschungen und Konflikte unvermeidlich.
Bekomme ich für Ehrenamtliches Engagement Dienstbefreiung?
Ehrenamtliche investieren viel Zeit in ihr Engagement. Viele Freizeiten und Seminare wären ohne deren aktive Mitarbeit nicht durchzuführen. So manches Engagement ist nur möglich und mit dem Berufsleben vereinbar, wenn dafür ein zusätzlicher Freiraum geschaffen wird. Privat Beschäftigte haben deshalb einen Rechtsanspruch auf bis zu 12 Tage im Jahr bezahlte Freistellung, wenn sie z.B. bei einer Konfirmanden- oder Kinderfreizeit mitarbeiten, die Ferienspiele begleiten oder an einer JULEICA Ausbildung teilnehmen.
Für Angestellte im Öffentlichen Dienst gelten gesonderte Regelungen.
Weitere Informationen sowie das Antragsformular finden unter diesem Link.
Kann eine Gemeinde ehrenamtliches Engagement bei Baumaßnahmen als Eigenleistung in Förderanträgen einbringen?
Grundsätzlich gilt: Zur Förderung von z.B. Kirchenrenovierungen ist ehrenamtliches Engagement in Form von Eigenleistungen ehrenamtlicher Gemeindeglieder äußerst erfreulich. Eine Teilnahme an Baumaßnahmen ist jedoch nur in beschränktem Umfang und nicht bei jeder Tätigkeit möglich.
Bei der Betrachtung der auszuführenden Bautätigkeiten listet deshalb eine Architektin oder ein Architekt zunächst mögliche Aufgaben auf, welche in Eigenleistung erbracht werden können. Fachmännische Aufgaben, wie z.B. Maurer- und Schreinerarbeiten, müssen dabei durch Fachpersonal ausgeführt werden.
Die ehrenamtlichen Helfer können jedoch Aufgaben übernehmen, welche auch von Laien erledigt werden können. Dies wären zum Beispiel das Aus- und Einräumen des Inventars, der Aus- und Einbau der Kirchenbänke, die komplette Baureinigung, der Abbruch von Bodenplatten und des Holzsockels (Bankpodest) oder auch die Auskofferung und der Erdaushub in und an der Kirche.
Werden diese Aufgaben von Mitgliedern der Kirchengemeinde übernommen, muss keine Firma beauftragt werden, wodurch es zu einer Kostenersparnis kommt.
Es wird die Höhe der Kosten ermittelt, welche eine Firma für die geleisteten Arbeiten berechnet hätte und als €-Position auf der Kostenseite mit in die Kostenberechnung nach DIN 276 eigerechnet (Aufwand).
Der so ermittelte Betrag steht dann in € als Eigenleistung auch im Finanzierungsplan der Maßnahme. Der am Ende durch die Eigenleistung der Kirchengemeinde eingesparte Betrag ist als „eingespart“ zu verzeichnen (Ertrag).
Ansprechpartner im Baudezernat:
Jörn Kring
Kirchenverwaltungsoberrat
Tel.: (0561) 9378-333
Tel. Sekretariat: (0561) 9378-368 (Jessica Rother)
Fax: (0561) 9378-441
E-Mail: joern.kring@ekkw.de
Welche Anerkennungskultur passt zu unserer Organisation oder Kirchengemeinde?
Vielleicht sollte Sie die Frage genau andersrum stellen? Nicht: Was passt zu uns, sondern: Welche Anerkennung passt zu den Ehrenamtlichen, die sich in unserer Organisation/Gemeinde arbeiten?
Wir alle brauchen es als Menschen: Mit dem, was wir tun und wie wir sind, von anderen gesehen, an-erkannt zu werden. Was genau das für den oder die Einzelne/n heißt, ist allerdings ganz unterschiedlich. Eine Kultur der Anerkennung zu pflegen, beinhaltet daher, individuell zu gucken und nicht alle über einen Kamm zu scheren. Eine wertschätzende Grundhaltung, Fingerspitzengefühl und Kreativität sind dabei ebenso hilfreich wie ganz konkretes Nachfragen.
Die komplette Antwort finden Sie hier! Und im Menüpunkt Materialien satte 101 Möglichkeiten, Danke zu sagen.
Brauche ich ein polizeiliches Führungszeugnis (Kindesschutz) ?
Seit einigen Jahren ist das Thema Kindeswohlgefährdung und Kindesschutz in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung wurde mit den Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) auch auf Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe ausgeweitet. Damit haben alle Mitarbeitenden auch in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit einen Schutzauftrag für die ihnen anvertrauten Kinder- und Jugendlichen.
Weitere Informationen sowie entsprechende Downloads zu diesem Thema (z.B. Polizeiliches Führungszeugnis) finden Sie unter diesem Link.
Sind Arbeitslose zu faul fürs Ehrenamt?
Warum nur engagieren sich so wenige Erwerbslose? Wollen die nicht? Die Forscherin Prof. Dr. Chantal Munsch von der Uni Siegen hat einen ganz anderen Grund gefunden:
Man lässt die Leute nicht. Wie wir Menschen vom Ehrenamt ausgrenzen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, darauf gibt sie Hinweise im Interview mit der Zeitschrift Chrismon.
Wir stellen es Ihnen als Download bereit.
Was tun bei Konflikten mit Freiwilligen?
Konflikte gehören zum Leben dazu. Menschen sind nun mal verschieden und verfolgen unterschiedliche Interessen, auch wenn sie viele Werte teilen und sich gemeinsam für eine Sache engagieren. Konflikte kosten Zeit, Nerven und Ressourcen. Sie können aber auch Anstoß für notwendige oder kreative Veränderungen und Entwicklungen sein.
Auch bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen kann es zu Konflikten kommen. Oft geht es dabei um unterschiedliche Werte, Sichtweisen und Interessen sowie strukturelle Unklarheiten.
Was tun, wenn Sie merken, dass sich ein Konflikt mit einer oder einem Ehrenamtlichen anbahnt oder sogar schon richtig im Gang ist? Bevor Sie aktiv werden empfiehlt es sich kurz innezuhalten und tief durch zu atmen. Vergewissern Sie sich um was genau es geht, es Ihnen geht. Nehmen Sie sich, Ihren Ärger oder Ihre Verunsicherung ernst. Überlegen Sie auch, wie der Andere die Situation beschreiben würde. Und dann reden Sie über das, was Sie bewegt. Je eher desto besser. Als Koordinator/in sind Sie in einer besonderen Rolle und auch Verantwortung. Im günstigsten Fall haben Sie Gelegenheit Supervision in Anspruch zu nehmen. Hier können Sie in geschütztem Raum Distanz zum Geschehen gewinnen, Ihre eigene Rolle klären und weiteres Vorgehen überlegen. Falls dies nicht möglich ist, sprechen Sie gezielt eine Person Ihres Vertrauens an und bitten Sie um ein Gespräch. Es erfordert Mut und Überwindung das Gespräch zu suchen. Aber es lohnt sich. Vielleicht kann später auch ein gemeinsames Gespräch der am Konflikt Beteiligten stattfinden.
Und wenn Ihnen niemand einfällt, den Sie ansprechen können? Dann wenden Sie sich an uns: engagiert@ekkw.de. Wir werden versuchen Ihnen jemand zu nennen, mit dem/der Sie Ihr Anliegen besprechen können. Dazu können auch professionelle Moderatoren oder Gemeindeberaterinnen gehören.
Ein sehr guter Artikel zum Thema Konflikte/Konfliktmanagement in der Arbeit mit Freiwilligen stammt von der Supervisorin Katharina Witte. Er ist 2010 im Newsletter Wegweiser Bürgergesellschaft erschienen. Hier können Sie ihn als Download herunterladen.
Wie trennen wir uns von Ehrenamtlichen?
Diese Fragestellung weckt bei vielen FreiwilligenkoordinatorInnen ganz unterschiedliche Gedanken.
Möglichkeit A: Alles hat ein Ende, auch ehrenamtliches Engagement. Dafür sind unterschiedliche Formen der Würdigung und Verabschiedung möglich. Andere Freiwilligenkoordinatoren/innen und hauptamtlich Mitarbeitende haben beim Thema der Trennung von Ehrenamtlichen andere Situationen vor Augen: Ehrenamtliche, die von ihrer Aufgabe über- oder unterfordert sind, es aber nicht wissen. Ehrenamtliche, die viel klagen, aber keine Konsequenzen ziehen wollen. Ehrenamtliche, die zu einer Belastung für das Team weiterer Ehrenamtlicher werden. Ehrenamtliche, die sich an Hauptamtlichen als Konfliktfolie abarbeiten… die Liste ist unvollständig.
Hier lautet die Frage im schlechtesten Falle: Wie werden wir bestimmte Ehrenamtliche wieder los? Oder im besseren Fall: Wie ermöglichen wir Ehrenamtlichen den Übergang in ein anderes Engagementfeld, das ihren Gaben und Ressourcen besser entspricht?
Mehr erfahren Sie hier!
Partizipation: Müssen wir Ehrenamtliche mitbestimmen lassen?
Die Mitbestimmung von Ehrenamtlichen beginnt bereits mit ihrem Interesse an einem Ehrenamt. Denn sie bestimmen, ob sie wollen oder nicht, ob sie weitermachen oder aufhören. (Lediglich für wenige staatliche Ehrenämter kann eine behördliche Verpflichtung mit der Androhung von Zwangsmitteln erfolgen, wie z.B. beim Schöffenamt.) Ehrenamtliches Engagement geschieht daher nahezu ausschließlich auf der Grundlage von Freiwilligkeit. Ehrenamtliche wollen teilhaben (partizipieren). Sie wollen mitgestalten und mitentscheiden. Ehrenamtliche bringen ihre Zeit, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihr Können ein. Das tun sie, weil ihnen eine Sache wichtig ist und sie an der Gestaltung teil-haben wollen – und das ist nur mit Mitbestimmung möglich. Vor diesem Hintergrund ist die Frage nur zu bejahen. Ehrenamtliche müssen zumindest in den ihr Ehrenamt unmittelbar betreffenden Angelegenheiten mitbestimmen können. Wie groß oder klein der Bereich der Mitbestimmung ist, wird in unterschiedlichen Arbeitsbereichen unterschiedlich sein. Entscheidend ist jedoch, dass die Möglichkeiten ehrenamtsfreundlich ausgeschöpft und die etwaige unverrückbare Grenzen sachlich begründet und ebenso offen wie eindeutig benannt sind. Für ehrenamtliche Vorstandstätigkeiten ist hingegen eine umfassende, auf „Augenhöhe“ mit hauptamtlich Mitarbeitenden verankerte Mitbestimmung schlicht eine unumgängliche Voraussetzung, ohne die es nicht geht.
Schadet es dem Ehrenamt, wenn es bezahlt wird?
Ja. Arbeiten für Geld ist Erwerbsarbeit. Das ehrenamtliche Engagement ist ein un-entgeltliches Engagement. Diese Feststellung betrifft nicht die Auslagenerstattungen! Dass Ehrenamtliche ihre Auslagen (Fahrtkosten, Bastelmaterial, Fortbildungen, Telefongebühren usw.) erstattet bekommen, soll vielmehr eine gute Regel sein. Der Einsatz von Geld ist dann hilfreich, wenn er hilft, dass Freiwillige neben ihrer Zeit nicht noch eigenes Geld investieren müssen, um für ihr Engagement gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Geld ist aber Gift, wenn im Ehrenamt Zeit mit Geld (z.B. 5,00 Euro je Stunde) verrechnet wird. So eingesetztes Geld verdirbt das Ehrenamt.
Weitere Informationen finden Sie im Positionspapier der bagfa und im Artikel "Geld und Ehrenamt" von Dr. Ralph Fischer.
Was muss ich als Freiwilligenkoordinator/in in puncto Datenschutz bedenken?
Beispiel 1: Eine große Veranstaltung mit Ehrenamtlichen. Am Eingang hängt an Pinwänden eine große Liste aller Teilnehmenden. Darauf stehen eingetragen und gut sichtbar die Namen der Einzelnen plus deren private E-Mail-Adressen. Achtung: Geht gar nicht!!!
Beispiel 2: Sie schlagen den Gemeindebrief auf. Auf Seite 13 prangt ein Foto, das plastisch zeigt, wie Sie selbst bei der letzten Gemeindefreizeit – sehr hungrig und sehr unvorteilhaft – Spaghetti Bolognese essen. Auweia!!! Eigentlich ist Datenschutz ganz einfach. Grundsätzlich gilt: Persönliche Daten müssen geschützt werden! Sie dürfen nur für den ursprünglichen Zweck genutzt werden und dürfen nicht weitergegeben geschweige denn öffentlich gemacht werden! Es sei denn, die Person stimmt zu. Deshalb müssen Sie mit den Daten der Ehrenamtlichen sehr sorgfältig umgehen.
Wenn jemand aus dem Ehrenamt ausscheidet, müssen Sie als FreiwilligenkoordinatorIn seine/ihre Daten löschen (es sei denn, die Ehrenamtlichen möchten weiter informiert werden, z.B. mit dem Newsletter. Auch hier muss nachgefragt werden – also eine erneute Zustimmung eingeholt werden).
Auch das Recht am eigenen Bild – egal ob hübsch oder hässlich – fällt unter den Datenschutz. Das heißt, Sie dürfen Bilder nur dann verwenden, wenn die darauf abgebildete Person damit einverstanden ist (bei Kindern müssen auch deren Eltern das Okay geben). Sie können sich allerdings eine Einverständniserklärung holen, dass Sie Fotos der Freiwilligen für die Pressearbeit, die Gemeindehomepage o.ä. generell nutzen dürfen. Natürlich gebietet die Fairness, dass Sie vor der Veröffentlichung von neuen Fotos die Freiwilligen immer noch einmal fragen, ob auch dieses Foto verwendet werden darf!
Ihr Umgang mit den Daten der Ehrenamtlichen ist das eine – der Umgang der Ehrenamtlichen mit den Daten derer, die ihnen anvertraut sind, noch etwas anderes. Als FreiwilligenkoordinatorIn sind Sie vielleicht auch für Ehrenamtliche im Besuchsdienst zuständig oder für Freiwillige in der Kinder- und Jugendarbeit. Also müssen Sie Sorge dafür tragen, dass auch Ihre Ehrenamtlichen gut informiert sind. Sie müssen Sie über die Sorgfältigkeitspflicht aufklären und über die Pflicht zur Verschwiegenheit.
Wenn Sie jetzt sagen: „Hmh, das klingt doch zu kompliziert, was mache ich denn, wenn…?“, dann ist das kein Problem: Die Landeskirche hat einen Datenschutzbeauftragten, der komplizierte Dinge einfach erklären kann und mit Ihnen guckt, worauf Sie achten müssen. Rufen Sie Michael Horst einfach an oder schicken Sie im eine Mail – er hilft Ihnen gern weiter!
Michael Horst
0561 - 9378 337
michael.horst@ekkw.de
Zu alt fürs Ehrenamt in Kirche und Diakonie?
Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit (EAFA) stellt fest, das in etwa der Hälfte der evangelischen Landeskirchen Verfassungen, Grund- oder Wahlordnungen Altersgrenzen für Ehrenämter vorsehen. Auch in unserer Landeskirche gab es bis Ende 2014 eine solche Altersgrenze - KirchenvorsteherInnen durften ab 70 nicht mehr kandidieren. Im Rückblick mögen Altersgrenzen verschiedene Berechtigungen gehabt haben; diese gehen jedoch in der Regel mit eher negativen Altersbildern einher.
In unserer Fachstelle Engagementförderung meinen wir, dass solche Regelungen fragwürdig sind. Eine zeitgemäße Kirche, die den Anspruch hat, eine „Kirche für alle“ zu sein, grenzt keinen erwachsenen Menschen aufgrund des kalendarischen Alters aus. Der Blick richtet sich vielmehr darauf, welches Erfahrungswissen, welche Fertigkeiten und Kompetenzen für die Ausübung des Ehrenamtes förderlich sind. Daneben ist bei der Besetzung von Ehrenämtern, wie z. B. im Kirchenvorstand, der Aspekt der Generationengerechtigkeit zu beachten – die Interessen aller Altersgruppen sollten dort vertreten werden.
Was aber ist, wenn Sie den Eindruck haben, dass eine/r Ihrer Ehrenamtlichen aufgrund von altersbedingten Einschränkungen tatsächlich nicht mehr in der Lage ist, sein Ehrenamt gut auszuüben? Überlegen Sie zunächst, ob dieser Eindruck tatsächlich stimmt und seien Sie dabei auch ehrlich mit sich selbst (denn ob wir einen Ehrenamtlichen „anstrengend“ finden, hat manchmal mehr mit uns selbst zu tun als mit seinen Qualitäten, die er in die Tätigkeit einbringt). Wenn ja, ist Klarheit gefordert und ein behutsam geführtes Gespräch.
Übrigens: Pflegt man von Anfang an eine gute Feedback-Kultur, führt regelmäßige Gespräche und beweist Offenheit für Lob und (konstruktive) Kritik, braucht man unserer Erfahrung starre Konstrukte wie Altersgrenzen nicht. Es ist alles eine Frage der Kommunikation.
Hier können Sie sich die Broschüre der Evang. Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in der EKD (EAFA) herunterladen.
Wie viel Geld braucht das freiwillige Engagement?
Es wäre ein Trugschluss zu glauben, freiwilliges Engagement würde kein Geld kosten, denn Freiwillige arbeiten nicht im luftleeren Raum! Und es soll ein allgemeiner Standard sein, dass Freiwillige für ihr Engagement kein Geld mitbringen müssen. Denn die Gefahr, Menschen aus prekären Verhältnissen auszuschließen, ist groß.
Wofür wird nun Geld gebraucht? Natürlich geht es beim freiwilligen Engagement um unentgeltliche Tätigkeiten, doch diese Arbeit soll in einem guten Rahmen stattfinden – und da fallen in aller Regel Kosten an. Zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit, Telefon- und Portokosten sowie Bürobedarf, Auslagen für Materialien und Fortbildungen.
Daneben können Kosten für weitere Auslagen der FreiwilligenkoordinatorInnen selbst, Büromiete und Fahrtkosten entstehen. Und schließlich wird Geld für eine individuelle, angemessene Anerkennungskultur benötigt, wie z. B. an Geburtstagen, für langjährige Tätigkeit, an Festtagen oder zum Abschied.
Kalkulieren Sie die entstehenden Kosten für die Arbeit mit Freiwilligen und planen Sie sie von Anfang an fest im Jahreshaushalt Ihrer Einrichtung und Gemeinde ein. Hier Prioritäten zu setzen und feste Regelungen zu treffen zeigt auch die Ernsthaftigkeit und den Grad an Wertschätzung, den Sie dem Engagement zuweisen. Und ist außerdem eine lohnende Investition, die sich in vielerlei Hinsicht „auszahlt“ und multipliziert. Finden wir.
Hier können Sie sich das Formular zur Kostenerstattung herunterladen.
Und wo bekomme ich Geld her? Finanzierungsquellen
Geht es um eine einmalige kleinere Zuwendung oder benötigen Sie regelmäßig größere Summen? Wichtig ist, dass Sie sich im Vorfeld überlegen, wie viel Geld oder Sachmittel Sie für die geplante Aktion benötigen.
Können Sie die notwendigen Beträge im Gemeindehaushalt verankern? Sie können sich z. B. um Spenden von Selbständigen und Firmen bemühen oder um Anlassspenden z.B. bei Geburtstagen oder Jubiläen. Kreativität und persönliche Ansprache bringen oft überraschende Ergebnisse.
Oder Sie nehmen Kontakt zu Experten im Fundraising auf, die Sie in Kirche und Diakonie finden.
Kontakt Spendenwesen in der EKKW: Joachim.Pothmann@ekkw.de
Hier erhalten Sie Unterstützung beim Aufbau von Fundraising in ihrer Kirchengemeinde, aber auch Tipps für die Beantragung von Fördermitteln z.B. bei Stiftungen und öffentlichen Trägern.
Hilfreich ist es, im Vorfeld ein Konzept (Zielsetzung, Verwendungsweck z. B. Finanzierung von Materialien, Raummiete, Honorare oder Umbaukosten), eine Kalkulation sowie einen möglichen Finanzierungsplan zu entwickeln. Gibt es vielleicht auch Einnahmen?
Gibt es Unterstützung vom Land?
Ja, das Land Hessen hält eine ganze Reihe an hilfreichen Unterstützungsangeboten bereit – und bestimmt kann auch Ihre Organisation oder Gemeinde davon profitieren (oder tut das bereits). So bieten die Ehrenamtskampagne „gemeinsam aktiv“, die „Landesehrenamtsagentur Hessen“ sowie die Landesstiftung „Miteinander in Hessen" umfassende Möglichkeiten zur Förderung des freiwilligen Engagements.
Sei es das Qualifizierungsprogramm für Ehrenamtliche, bei dem Zuschüsse für Fortbildungen beantragt werden können, Formulare wie der Kompetenznachweis oder das Zeugnisbeiblatt Ehrenamt, eine hessenweite Engagementdatenbank bis hin zur Unterstützung von Freiwilligentagen. Und noch viel mehr!
Einen ausführlichen Überblick über die einzelnen Angebote können Sie sich hier verschaffen.